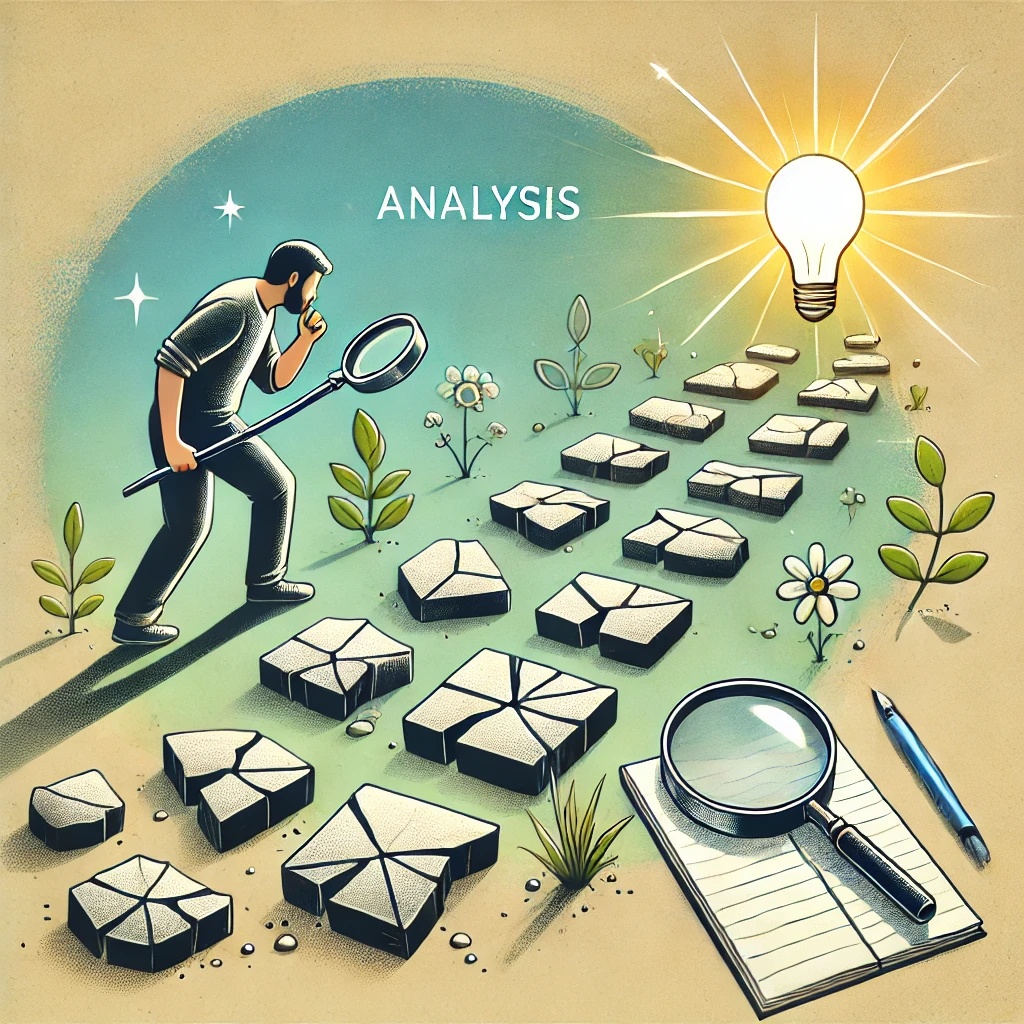Wie evidenzbasierte Politik Zukunft gestalten kann? Eine Politik, die individuelle Freiheiten wahrt und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse berücksichtigt, ist das Rückgrat einer prosperierenden Gesellschaft. Sie bildet das Fundament, auf dem Innovation, Stabilität und Fortschritt wachsen können. Doch gerade in Deutschland beobachten wir in den letzten Jahren eine zunehmende Diskrepanz zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und politischer Praxis – eine Entwicklung, die das Potenzial hat, gesellschaftlichen Fortschritt zu bremsen und Vertrauen zu erschüttern.
Wie lässt sich diese Diskrepanz konkret veranschaulichen? Exemplarische Beispiele aus den Bereichen Energie, Industriepolitik und Bildung verdeutlichen die Dringlichkeit einer evidenzbasierten und zugleich robusten politischen Ökonomie.
Inhaltsverzeichnis
Energiepolitik: Die Herausforderungen für evidenzbasierte Politik
Man kann gegen den Strom schwimmen, aber nie gegen die Stromrechnung1
Unternehmen, die Techniken der Zukunft produzieren, werden sich in Ländern ansiedeln, wo Strom günstig und zu genüge vorhanden ist. In Deutschland hat sich der Industriestrompreis schon 2021 – also noch vor dem Krieg in der Ukraine – von 6,05 c/kwh auf 31,38 c/kwh erhöht. In GB bezahlte man zu diesem Zeitpunkt knapp 19 c/kwh und in den USA circa 9 c/kwh!
Was die Energiepreispolitik betrifft, setzt Deutschland oft auf kurzfristige Maßnahmen wie den Industriestrompreis, der zwar temporäre Entlastung schafft, aber keine nachhaltige Lösung für strukturelle Probleme bietet. Ein positives Gegenbeispiel dazu ist Norwegen, dass langfristige Investitionen in die Infrastruktur tätigt und pauschale Subventionen vermeidet und regionale, wettbewerbsorientierte Preismodelle ermöglicht. Übrigens: Ein deutscher Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 2.500 bis 5.000 kwh zahlte im ersten Halbjahr 2024 durchschnittlich 39,5 c/kwh, in Norwegen lag der Preis bei etwa 19,9 c/kwh und auch die Industrie in Deutschland zahlt einen deutlich höheren Preis als in Norwegen. Natürlich hat Norwegen gegenüber Deutschland einen natürlichen Vorteil durch bessere Nutzbarkeit der kostengünstigen Energiegewinnung aus Wasserkraft aber das erklärt nicht die hohen Preisunterschiede.
„Die dümmste Energiepolitik der Welt“2
Deutschland möchte mit seinem Anteil von ca. 1,5 % der weltweiten CO2-Emmission ein globaler Vorreiter in grüner Technologie sein. Trotz des Ausbaus der erneuerbaren Energien bleibt Deutschland hinter seinen hohen Ansprüchen in der Energiepolitik zurück. Von 02.11. – 08.11.2024 und vom 10.12. – 13.12.2024 führte eine jahreszeitentypische Großwetterlage zu einer Dunkelflaute3 worauf in Deutschland die Stromversorgung durch Erneuerbare Energie zusammenbrach und ein Viertel des deutschen Strombedarfs importiert werden musste. Als Konsequenz des Ausstieges aus der Energiegewinnung aus Atomkraftwerken, einer unterbrochenen Gasversorgung und mangels ausreichend Stromversorgung aus Sonne, Wind und Wasser sah man sich sogar gezwungen stillgelegte Kohlekraftwerke zu reaktivieren um „schmutzige“ Kohle zu verstromen!
Ein blamables Ergebnis der hochgepriesenen Energiewende, die einfach ungeliebte Energiequellen stilllegte, ohne die Alternativen und die richtige Schrittreihenfolge zu berücksichtigen. Es gibt wohl kaum ein Land wie Deutschland, in dem Kraftwerke auf sehr hohem Sicherheitsstandard ohne Not kurzfristig abgedreht wurden und mangels ausreichender Alternativkapazitäten durch teure Stromimporte ersetzt werden mussten. Das „Wall Street Journal“ bezeichnete 2019 die deutsche Energiepolitik als „dümmste Energiepolitik der Welt“. Bis heute ist das schwer widerlegbar, Deutschland sollte jedoch danach trachten, dass es sich nicht um eine Auszeichnung für ein „Lebenswerk“, sondern nur für eine „Epoche voller Missverständnisse“ war. Ergänzenswertes zum Thema findest Du HIER.
In Zukunft Technologieoffenheit statt Ideologie und Branchenlobbyismus
Während erneuerbare Energien eine wichtige Rolle für die nachhaltige Energieversorgung spielen, sind sie allein nicht in der Lage, den steigenden Strombedarf zu decken, insbesondere bei gleichzeitiger Abschaltung von CO2-neutralen Atomkraftwerken. Ein Wiedereinstieg in die Kernkraft – wie ihn Frankreich und andere europäische Länder erfolgreich umsetzen – würde Deutschland zweifelsfrei helfen, langfristig stabile und klimafreundliche Energiequellen zu schaffen.
Die Förderung einzelner Unternehmen mag kurzfristig attraktiv erscheinen, schafft jedoch oft ein Ungleichgewicht, das den Wettbewerb verzerrt. Ein Beispiel dafür sind die Subventionen im Rahmen von Zukunftstechnologien wie Batteriefabriken, die mit Milliarden gefördert werden, während andere Sektoren unter bürokratischen Hürden leiden.
Der Net Zero Industrial Act der EU zeigt, dass Beschleunigung in Entscheidungsverfahren ein wirkungsvolles Mittel sein könnte, um die Industriepolitik zukunftsfähig zu gestalten. Der NZIA zielt darauf ab, umweltfreundliche Branchen wie Photovoltaik, Windenergie, Batterie-technologien, Wärmepumpen, Wasserstofftechnologien und CO₂-Abscheidung und -Speicherung zu fördern, schließt jedoch die CO2-emmissionsfreie Stromerzeugung durch Atomenergie aus.
Die Kritik, dass der Net Zero Industry Act (NZIA) ein ideologisches Produkt bleibt, solange er die CO2-emissionsfreie Stromerzeugung durch Atomenergie ausschließt, hat durchaus Substanz. Diese Haltung ist nicht unbegründet, da der Ausschluss der Kernkraft aus den Prioritäten des NZIA weniger durch wissenschaftlich-technische Argumente als durch politische und ideologische Konflikte innerhalb der EU bedingt ist.
Vorwärts in die Gegenwart statt zurück in die Zukunft!
Während der NZIA derzeit primär auf erneuerbare Technologien abzielt, wäre es in Deutschland wirtschaftlich naheliegend, Atomkraft in die Überlegungen stärker einzubeziehen. Eine mögliche Integration könnte über ergänzende Programme oder durch Förderung neuer Technologien wie SMRs erfolgen. Dies würde der EU helfen, ihre Klimaziele zu erreichen, während sie gleichzeitig ihre Energieversorgung diversifiziert und sich international wettbewerbsfähig positioniert. Deutschland könnte davon lernen, indem es breit gefächerte Strukturmaßnahmen priorisiert und Subventionen sorgfältig evaluiert. Die Schweiz, die 2011 unter dem Eindruck der durch einen Tsunami4 verursachten Kernschmelze des Atomkraftwerkes Fukushima beschloss, schrittweise aus der Atomenergie auszusteigen, hob im August 2024 das Verbot für den Bau neuer Kernkraftwerke auf, wird also auch in Zukunft auf Atomkraft setzen.
Österreich ist wahrscheinlich das einzige Land der Welt, dass ein voll funktionsfähiges Atomkraftwerk fertiggebaut hat um es danach nie in Betrieb zu nehmen. Am 05. November 1978 stimmte eine knappe Bevölkerungsmehrheit von 50,47 % gegen die Nutzung von Kernkraft in Österreich. Eine hohe Nutzungsmöglichkeit von Wasserkraft, Atomstrom durch die Hintertüre (Import von Atomstrom) und der Glaube, dass der Strom sowieso aus der Steckdose kommt, sorgen dafür, dass das Thema seit damals mehr oder weniger ein Tabu ist.
Ungeachtet der ideologiegeprägten Energiepolitik in Deutschland und Österreich hat angesichts des Desasters der deutschen Energiewende weltweit ein pragmatisches Umdenken stattgefunden, dass dazu führte, dass das Interesse an der Kernenergie nunmehr so groß wie seit der Ölkrise in den 1970er Jahren ist und die internationale Energiebehörde IEA einen neuen weltweiten Rekord bei der weltweiten Produktion von Atomstrom avisiert.
Im übrigen gehörte Österreich, neben Ungarn und der Slowakei bis November 2024 zu den einzigen EU-Ländern mit Importen von russischem Gas. Nach einem Rechtsstreit mit dem österreichischen Erdölversorgers OMV hat die russische Gazprom einen Lieferstopp verhängt. Wenn nach dem heurigen Winter die Gasspeicher wieder leer sind muss Österreich muss nach einer alternativen Versorgungsquelle Ausschau halten. Man ist zwar nicht mehr an den langfristigen Vertrag mit dem russische Unternehmen gebunden, aber die Marktabhängigkeit stieg und ob hinkünftig in Norwegen oder anderen westlichen Ländern das Gas billiger eingekauft werden kann, darf bezweifelt werden.
Und in Zukunft?
Dass China, USA, Russland oder Indien ihren steigendem Energiebedarf nach deutschem Vorbild lösen, ist wohl kaum anzunehmen. Fossile Brennstoffe, die in Deutschland nicht mehr zur Stromgewinnung oder für das Heizen verwendet werden, finden ihre Verwendung anderswo. Wie man den höheren Strombedarf durch Elektroautos und KI-Technologie tilgen will, wenn man den aktuellen Bedarf bereits nur durch Stromimporte decken kann, bleibt rätselhaft.
Stell Dir vor: Du verdienst hohe Provisionen mit Produkten, die Kunden begeistern, sich quasi von selbst verkaufen und von einer Marke getragen werden, der Menschen vertrauen. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Dann klicke HIER und überzeuge dich selbst!
In Brüssel fabuliert man von Netto-Null bis 2050 für die EU, die 5,50 Prozent der Weltbevölkerung ausmacht! China peilt dieses Ziel für 2060 und Indien für 2070 an. Aus Russland und Afrika sind keine Planungsziele bekannt. Für die ist nach der Wahl Donald Trumps ein Kurswechsel zu Gunsten wirtschaftlicher Prioritäten zu erwarten, das von der Biden-Administration gesteckte Ziel einer Klima-Neutralität wird sicherlich rückverlegt werden müssen. Niemand also zwingt Europa zu seinem frühzeitigen Solo in die Klimaneutralität, dass uns bis jetzt nur sturheil in die Wirtschaftkrise schlittern ließ und das globale Klima unbeeindruckt lässt.
Der weltweite Stromverbrauch beträgt derzeit 26.600 TWh, bis 2050 soll er auf 76.600 TWh ansteigen. Die Batterie eines E-Autos besteht im Durchschnitt aus 11 kg Lithium, 14 kg Kobalt, 22 kg Nickel, 40 kg Kupfer und 50 kg Graphit. Der Bergingenieur Dr. Gerhard Kirchner recherchiert daraufhin alleine nur für die EU-Flotte mit derzeit 252,2 Millionen Kraftfahrzeugen einen Bedarf an diesen Metallen von 34,6 Mio. Tonnen.
Alleine die Umrüstung der europäischen Autoflotte auf Elektrobetrieb entspräche der weltweiten Gesamtproduktion von Lithium über 15 Jahre und Kobalt über 16 Jahre, den Ressourcenverbrauch für die Erzeugung „grüner“ Energie noch gar nicht eingerechnet. Und außerhalb Europas gibt es schließlich auch kräftigen Bedarf an diesen Metallen. Festzustellen ist also, dass über Ressourcenbedarf und Machbarkeit der Dekarbonisierung fatalerweise nicht nachgedacht wurde. Zeugnisnote Rechnen „Nicht genügend“ – Setzen!
Das Beispiel Schweden zeigt wiederum wie beschleunigte Planungsverfahren den Ausbau erneuerbarer Energien erleichtern können, ohne auf ideologische Blockaden zu stoßen. Um ideologische Blockaden zu minimieren, setzt Schweden auf frühzeitige Einbindung und Dialog mit den Stakeholdern und etwaige Kompensationsmaßnahmen. Diese dialogorientierte Konfliktlösung hat es auch erleichtert, dass die Berufungsinstanzen eingeschränkt werden konnten und zusätzlich wurden die Umweltverträglichkeitsprüfungen standardisiert sowie die Genehmigungsverfahren digitalisiert und transparent gemacht. Anstatt wechselseitiger Blockadepolitik tritt zunehmend Projektfortschritt auf breiter Akzeptanz in den Vordergrund und so ist es auch möglich, gesetzliche Fristen im Sinne verkürzter Genehmigungsverfahren einzuhalten.
Will man industriellen Fortschritt mitgestalten und den gesellschaftlichen Wohlstand sichern, wären im Sinne einer evidenzbasierten, robusten Energiepolitik konkrete und konsequente Maßnahmen notwendig:
- Prüfung und Nutzung der Potentiale innovativer Technologien wie CCS (Carbon Capture & Storage), Wasserstoff (dient als sauberer Energieträger) und Digitalisierung
- Reevaluieren des temporären Wiedereinstiegs in die CO²-freie Atomkraft und Intensivierung internationaler, wissenschaftlicher Zusammenarbeit5
- Erhalt von Wettbewerbsfähigkeit und Realitätsbewusstsein anstatt ideologischer Illusionen
- Abkehr von temporären Substitutionsmaßnahmen wie dem Industriestrompreis, welche den nötigen Ausbau der Infrastruktur nur verzögern
- Beschleunigung des Planungsverfahrens beim Ausbau der erneuerbaren Energien
- Maßnahmen, die technologieneutral sind, wie Abschreibungsprämien
- Globale Hebelwirkungen anstatt nationaler Detailziele, die laufend und weit verfehlt werden
Bildungspolitik
Evidenzbasierte Politik strebt mehr Autonomie für Schulen an
Das mittelmäßige Abschneiden Deutschlands in internationalen Bildungsrankings unterstreicht die Notwendigkeit von Reformen. Ein zentralstaatlich gesteuertes Bildungssystem hat sich als schwerfällig erwiesen. Beispiele aus Ländern wie Finnland zeigen, dass dezentrale Bildungspolitik, bei der Schulen mehr Freiheit in didaktischen und inhaltlichen Entscheidungen erhalten, bessere Ergebnisse liefern kann.
Eine evidenzbasierte Bildungspolitik sollte daher auf Rahmenfinanzierung durch den Staat setzen, während die inhaltliche Verantwortung stärker bei den Schulen verbleibt. Nur so können sie flexibler auf die spezifischen Bedürfnisse ihrer Schüler eingehen und innovative Ansätze testen. Die Abkehr von einem zentralbürokratischen Bildungssystem bedeutet jedoch nicht, dass der Staat sich aus der Kontrolle dezentraler bzw. privater Bildungsträger zurückzieht. Um eine flächendeckende Qualität der Bildung zu erreichen soll er die Einhaltung von Qualitätsstandards prüfen und durchsetzen. Länder wie England, Schweden und die Niederlande sind im Bereich der Schulautonomie gegenüber Deutschland weit voraus.6
Natürlich birgt jedes System seine Vor- und Nachteile in sich, das gilt auch für private Schulen. In England konnten durch die Einführung von privaten Schulträgern wie „free schools“ und „academies“ die Bildungsergebnisse eindeutig verbessert werden. Das Prometheus-Institut aus Deutschland hat sich auch mit den Gegenargumenten zu privatwirtschaftlicher Schulautonomie auseinandergesetzt und die Chancen & Risken in einem Gutachten im Dezember 2020 dargestellt. Dabei wird auch dargestellt, wie Schulautonomie auch in Deutschland inkrementell umgesetzt werden. Die empirischen Ergebnisse zeigen auch, dass Schulen in privater Trägerschaft keineswegs elitär sein müssen.
In Österreich wird die Bildungsdiskussion natürlich auch heftig geführt, die schon seit langem vorliegenden Hinweise auf die Chancen durch eine höhere Schulautonomie hatten in der Praxis des parteipolitisch verfilzten Schulsystems bis dato kaum nennenswerte Spuren hinterlassen. Ein gut gemeintes „Autonomiehandbuch“ des Bundesministeriums ist noch keine echte Autonomie.
Aversion gegen Veränderung: Das „Beamtendenken“ im Bildungssystem hat keine Zukunft
Ein großer Hemmschuh für Innovation ist die weit verbreitete Veränderungsresistenz bei Lehrkräften und Schulverwaltungen. Diese wird durch das Beamtenstatus-System und den Einfluss von Gewerkschaften verstärkt:
- Sicherheitsdenken statt Innovationskultur: Viele Lehrkräfte lehnen Neuerungen ab, weil sie damit Mehrarbeit oder eine Verschlechterung der eigenen Arbeitsbedingungen verbinden.
- Lähmende Strukturen: Gewerkschaften stellen sich häufig gegen Veränderungen, die überholte Arbeitsweisen infrage stellen könnten.
Lösungsansätze
- Förderung einer Innovationskultur: Durch gezielte Anreize für innovative Schulkonzepte und Weiterbildungen könnte eine Kultur der Veränderung gefördert werden.
- Aufbrechen festgefahrener Strukturen: Beispielsweise durch flexiblere Beschäftigungsmodelle für Lehrer, die nicht auf Lebenszeit verbeamtet werden.
Migration: Autonomie allein reicht in Zukunft nicht
Autonomere Schulen können flexibler auf Herausforderungen wie Migration reagieren, doch in sogenannten Brennpunktschulen verschärfen sich die Probleme weiterhin:
- Sprachbarrieren: Ein erheblicher Teil der Schüler beherrscht die deutsche Sprache nicht ausreichend, um am Unterricht teilzunehmen.
- Kulturelle Konflikte: Die Weigerung, mitteleuropäische Kultur- und Verhaltensnormen anzunehmen, führt zu Disziplinproblemen und einer schlechten Integration.
Lösungsansätze
- Verpflichtender Sprachunterricht vor Schuleintritt: Kinder, die nicht ausreichend Deutsch sprechen, müssen in vorschulischen Intensivprogrammen die Sprache erlernen, bevor sie regulären Unterricht besuchen.
- Nicht nur Werte vermitteln, sondern auch einfordern: Schulen müssen grundlegende Werte wie Toleranz, Respekt und Gleichberechtigung setzen verbindlicher vermitteln und auch von den Schülern einfordern. Es ist schon richtig, dass die Schule nicht die gesellschaftlichen Defizite egalisieren kann. Aber die Schulen müssen auch selbstständig durchgreifen können, wenn die eingeforderten Werte von Ignoranten und Intoleranten boykottiert werden. Das soll im Wiederholungsfall zum Schulausschluss führen.
- Zielgerichtete Ressourcen: Mehrsprachige Lehrkräfte, Sozialarbeiter und Förderprogramme müssen an Brennpunktschulen gezielter eingesetzt werden.
Digitalisierung in der Bildung: Ein Schlüssel zur Förderung mündiger Bürger und Wettbewerbsfähigkeit in Europa
Die Digitalisierung bietet eine große Chance, das Bildungs- und Ausbildungssystem so zu transformieren, dass es nicht nur mündige, gesellschaftsfähige und kritische Bürger hervorbringt, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit des DACH-Raums und Europas stärkt. Um dieses Potenzial auszuschöpfen, braucht es jedoch eine strategische, umfassende und ideologiefreie Implementierung digitaler Technologien im Bildungssystem.
Digitalisierung als Werkzeug für personalisiertes Lernen ist in Zukunft unumgänglich
Digitale Tools und Plattformen ermöglichen es, Schüler individuell zu fördern und sie dort abzuholen, wo sie stehen:
- Adaptives Lernen: Lernplattformen wie Moodle oder ILIAS können auf Basis von Daten individuelle Stärken und Schwächen analysieren und darauf abgestimmte Inhalte anbieten.
- Vielfältige Inhalte: E-Learning ermöglicht Zugang zu einem breiten Spektrum an Materialien, von interaktiven Simulationen bis zu Online-Vorlesungen. Dies befähigt Schüler, eigenständig und kritisch zu lernen.
- Förderung von Medienkompetenz: Digitale Technologien sind nicht nur Werkzeuge, sondern auch Lerninhalte. Der richtige Umgang mit digitalen Medien und die Fähigkeit, Informationen zu bewerten, sind Kernkompetenzen in der heutigen Gesellschaft.
Ziel: Ein Bildungssystem, das nicht auf Einheitsgröße setzt, sondern die individuelle Entwicklung und kritisches Denken fördert.
Vorbereitung auf die Arbeitswelt von morgen
Die Arbeitswelt verändert sich rasant durch Automatisierung und künstliche Intelligenz. Schulen müssen Schüler auf Berufe vorbereiten, die heute noch nicht existieren:
- Digitale Grundbildung: Schüler müssen die Fähigkeit entwickeln, digitale Technologien nicht nur zu nutzen, sondern auch zu verstehen und kritisch zu hinterfragen.
- Programmierung und technisches Verständnis: Bereits in der Grundschule könnten Programmierkenntnisse und Grundlagen von Technologie vermittelt werden, ähnlich wie Lesen, Schreiben und Rechnen.
- Lebenslanges Lernen: Digitale Tools befähigen Schüler, sich eigenständig weiterzubilden und sich an eine sich wandelnde Welt anzupassen.
Ziel: Die Vermittlung von Fähigkeiten, die Schüler in einer globalisierten und digitalisierten Arbeitswelt konkurrenzfähig machen.
Abbau von Bildungsungleichheiten
Digitale Bildung kann Barrieren abbauen und Chancengleichheit fördern:
- Zugang zu Bildung unabhängig vom Wohnort: Schüler in ländlichen Regionen oder bildungsfernen Haushalten können durch Online-Lernangebote gleiche Chancen wie ihre Altersgenossen in Städten erhalten.
- Förderung von Schülern mit besonderen Bedürfnissen: Digitale Technologien wie Text-to-Speech oder spezielle Lernsoftware erleichtern das Lernen für Schüler mit Behinderungen oder Sprachbarrieren.
- Kosteneffiziente Bildung: Digitale Lernmaterialien können die Kosten für Lehrbücher reduzieren und damit Bildung erschwinglicher machen.
Ziel: Ein gerechtes Bildungssystem, das allen Schülern die gleichen Chancen bietet.
Effizienzsteigerung in der Schulverwaltung
Die Digitalisierung kann auch die Schulverwaltung effizienter und ressourcenschonender gestalten:
- Vereinfachte Organisation: Systeme für digitales Klassenmanagement reduzieren den Papieraufwand und erleichtern die Kommunikation zwischen Lehrkräften, Schülern und Eltern.
- Automatisierung von Verwaltungsaufgaben: Digitale Tools können Routineaufgaben wie Notenverwaltung oder Anwesenheitskontrollen automatisieren und so Zeit für pädagogische Arbeit schaffen.
- Datengestützte Entscheidungen: Durch die Analyse von Leistungsdaten können Schulen und Bildungsträger fundierte Entscheidungen treffen, z. B. bei der Ressourcenverteilung.
Ziel: Mehr Zeit und Ressourcen für die pädagogische Arbeit, weniger für Bürokratie.
Herausforderungen und Lösungen für die Zukunft
Natürlich bringt die Digitalisierung auch Herausforderungen mit sich:
- Digital Divide: Nicht alle Schüler haben Zugang zu digitaler Infrastruktur. Lösung: Staatliche Investitionen in Hardware und Internetzugang für alle.
- Lehrerausbildung: Viele Lehrkräfte sind nicht ausreichend geschult im Umgang mit digitalen Technologien. Lösung: Fortbildungsprogramme und Anreize für digitale Weiterbildung.
- Datenschutz und Sicherheit: Schulen müssen sicherstellen, dass Schülerdaten geschützt werden. Lösung: Strenge Datenschutzrichtlinien und vertrauenswürdige Plattformen.
Gesundheitspolitik: Differenzierte Ansätze statt Pauschalmaßnahmen
Pauschale Maßnahmen wie die generelle Besteuerung von Alkohol und Tabak können zwar fiskalische Ziele erfüllen, scheitern aber oft an der Prävention schädlichen Konsumverhaltens. Forschungsergebnisse zeigen, dass zielgerichtete Besteuerungsmodelle, die auf Kaufpräferenzen von Konsumenten mit hohem Risiko abzielen, eine bessere Wirkung entfalten können.
Ein weiteres Beispiel ist der Umgang mit neuartigen Tabakprodukten, die nachweislich weniger gesundheitsschädlich sind als herkömmliche Zigaretten. Statt diese kategorisch zu verbieten, wie es in Deutschland häufig diskutiert wird, könnten sie als Ausstiegsalternative gefördert werden, um Raucher von schädlicheren Produkten wegzuführen.
Eine zukunftsorientierte Gesundheitspolitik erfordert klare, differenzierte Strategien, die den Bedürfnissen der Bürger gerecht werden, ohne in die Autonomie von Gesundheitseinrichtungen oder die Eigenverantwortung der Menschen einzugreifen. Der Staat sollte dabei Rahmenbedingungen schaffen, anstatt Gesundheitsunternehmen selbst zu führen. Politische Einflussnahme, besonders durch parteipolitische Besetzungen, schadet langfristig der Effizienz und Qualität der Versorgung und belastet sowohl Patienten als auch Steuerzahler. Eine präzise, bedarfsgerechte Ausgestaltung der Gesundheitspolitik ist unerlässlich, um die Herausforderungen im Gesundheitswesen nachhaltig zu bewältigen.
Der Staat als Regulierer, nicht als Unternehmer
- Klare Regeln statt Führung: Die Politik sollte klare gesetzliche Rahmenbedingungen vorgeben und ihre Einhaltung überwachen. Der Betrieb von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder anderen Gesundheitsdienstleistern gehört hingegen in die Hände von Fachleuten. Politiker sind keine Unternehmer – ihre Hauptaufgabe liegt in der Gestaltung sinnvoller Gesetze.
- Trennung von Politik und Betrieb: Parteipolitische Besetzungen von Führungspositionen in Krankenhäusern und anderen öffentlichen Gesundheitseinrichtungen führen häufig zu betriebswirtschaftlichen Fehlentscheidungen, die auf Kosten von Patienten und Steuerzahlern gehen. Expertise und Fachkompetenz müssen hier den Vorrang haben.
Lösungsansätze
- Einführung von unabhängigen Besetzungskommissionen für Leitungspositionen im Gesundheitswesen.
- Transparenzpflichten bei der Vergabe öffentlicher Aufträge und der Besetzung von Führungspositionen.
Präzise statt pauschaler Gesundheitsinvestitionen
- Gezielte Fördermaßnahmen: Anstatt Gelder mit der Gießkanne zu verteilen, sollte die Gesundheitspolitik punktuelle Maßnahmen fördern, die dem tatsächlichen Bedarf entsprechen. Dies betrifft z. B. den Ausbau von Pflegekapazitäten in Regionen mit hohem Bedarf oder die Modernisierung von Krankenhäusern.
- Regionale Unterschiede berücksichtigen: Gesundheitsbedürfnisse variieren stark zwischen Ballungsgebieten und ländlichen Regionen. Investitionen müssen diesen Unterschieden Rechnung tragen.
Lösungsansätze
- Einführung eines regionalisierten Gesundheitsbudgets, das auf Basis lokaler Bedarfsanalysen zugewiesen wird.
- Förderung von Telemedizin und digitalen Gesundheitslösungen, insbesondere für ländliche Gebiete.
Priorität für Prävention und Eigenverantwortung
Eine starke Gesundheitspolitik setzt auf Prävention, ohne den Bürger zu bevormunden oder zu entmündigen. Das Ziel muss sein, Menschen zu eigenverantwortlichem Handeln zu befähigen, um Erkrankungen vorzubeugen und Kosten langfristig zu senken.
- Prävention statt Reparaturmedizin: Die Politik sollte Präventionsprogramme stärken, etwa durch Informationskampagnen zu Ernährung, Bewegung und Stressbewältigung. Zugleich sollten Anreize für eine gesunde Lebensführung geschaffen werden.
- Keine Bevormundung: Präventionsmaßnahmen dürfen nicht in unnötige Regulierungen und Verbote münden. Der Bürger muss die Wahlfreiheit behalten, wie er seinen Lebensstil gestaltet.
- Eigenverantwortung fördern: Die Bürger müssen in die Lage versetzt werden, Gesundheitsentscheidungen selbstbestimmt zu treffen. Dies erfordert Zugang zu verständlichen Informationen und niedrigschwellige Angebote für Gesundheitsdienstleistungen.
Lösungsansätze
- Steuerliche Anreize für präventives Verhalten (z. B. Sportprogramme oder Vorsorgeuntersuchungen).
- Gesundheitsbildung in Schulen und am Arbeitsplatz zur Förderung von Eigenverantwortung.
Effizienz durch Digitalisierung und Entbürokratisierung
Die Digitalisierung kann das Gesundheitswesen effizienter und bürgernäher machen, indem Prozesse automatisiert und unnötige Bürokratie abgebaut werden. Gleichzeitig verbessert sie die Transparenz für Bürger und erleichtert die Inanspruchnahme von Leistungen.
- Digitale Gesundheitsakte: Einführung einer einheitlichen digitalen Patientenakte, die den Informationsfluss zwischen Ärzten, Krankenhäusern und Patienten optimiert.
- Entbürokratisierung: Vereinfachung administrativer Vorgänge, um Ärzte und Pflegepersonal von übermäßigen Dokumentationspflichten zu entlasten.
Lösungsansätze
- Investitionen in digitale Infrastruktur und einheitliche Standards für Gesundheitsdaten.
- Bürokratieabbau-Kommissionen, die gesetzliche Vorgaben regelmäßig auf ihre Praxistauglichkeit prüfen.
Patientenorientierung und nachhaltige Finanzierung
- Patienten im Mittelpunkt: Gesundheitsdienstleistungen sollten sich stärker an den Bedürfnissen der Patienten orientieren, statt primär politischen Zielen zu dienen. Wirtschaftliche Optimierungen sind kein Tabu. Im Gegenteil, von den dringend notwendigen Prozessverbesserungen sowie dem Bürokratieabbau profitieren Patient und Steuerzahler!
- Nachhaltige Finanzierung: Eine langfristig tragfähige Finanzierung des Gesundheitssystems ist entscheidend, um die Qualität der Versorgung zu sichern. Dazu gehört die Anpassung der Beiträge an demografische Entwicklungen und die Förderung innovativer Finanzierungsmodelle, wie z. B. öffentlich-private Partnerschaften.
Lösungsansätze
- Einführung von Feedbacksystemen, die Patientenmeinungen zur Verbesserung von Dienstleistungen einholen.
- Förderung von innovativen Modellen, wie Pay-for-Performance-Systemen, bei denen Qualität belohnt wird.
Differenzierte Gesundheitspolitik für die Zukunft
Eine differenzierte und zielgerichtete Gesundheitspolitik kann die Herausforderungen im Gesundheitswesen bewältigen und eine qualitativ hochwertige Versorgung sicherstellen. Der Staat muss sich dabei auf seine Rolle als Regulierer und Rahmensetzer konzentrieren, während er Fachleuten die operative Führung überlässt. Investitionen müssen treffsicher und bedarfsorientiert erfolgen, um effizient eingesetzt zu werden. Prävention und Eigenverantwortung sind dabei Schlüsselstrategien, die langfristig die Kosten senken und die Gesundheit der Bevölkerung verbessern können.
Nur so kann das Gesundheitssystem zukunftssicher gestaltet werden – zum Wohl von Patienten, Steuerzahlern und einer wettbewerbsfähigen Gesellschaft.
Fazit:
Eine Politik, die sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigt als auch pragmatische Lösungen bietet, kann den Herausforderungen unserer Zeit gerecht werden. Die robuste politische Ökonomie bietet hier wertvolle Ansätze, um evidenzbasierte Politik mit nachhaltigen und zugleich freiheitsschützenden Maßnahmen zu verbinden. Ob die neue deutsche Koalitionsregierung dazu imstande ist, wird sich noch weißen.
- Klaus Klages (1938 – 2022), deutscher Gebrauchsphilosoph und Abreißkalenderverleger ↩︎
- Im Jahr 2019 erschien im „Wall Street Journal“ ein Artikel über die deutsche Energiepolitik mit dem Titel „World’s Dumbest Energy Policy“ ↩︎
- Windflaute bei gleichzeitig minimaler Sonneneinstrahlung ↩︎
- Die Katastrophe war nicht primär ein Reaktorunfall im klassischen Sinne, sondern wurde durch einen Tsunami in einer Größenordnung ausgelöst gegen den die Anlage nicht ausreichend geschützt war, obwohl Japan in einer seismisch aktiven Region liegt. Dieser schwere Unfall war auch der Auslöser für den Atomkraftausstieg Deutschlands unter der Regierung Merkel. ↩︎
- z. B. mit der internationalen Atom-Energie-Behörde und der Atoms4NetZeo-Initiative, aber auch mit Forschungsinstituten und Atomkraftwerkbetreibern bezüglich der laufenden Entwicklungen zu Reduzierung und Endlagerungs-Technologien von hochradioaktiven Atommüll ↩︎
- in der Schweiz werden Disziplinen wie Bildung und Steuern tendenziell autonom in den Kantonen -also lokal und nicht zentral vom Bund – verwaltet. ↩︎